Sind Liquid-Aromen giftig oder krebserregend? 55 Stoffe im Faktencheck
E-Zigaretten und Liquids sind ausschließlich für Personen ab 18 Jahren bestimmt. Nikotin kann abhängig machen.
Geprüft von Oliver Prust · Inhaber MaxVapor.de, seit 2012 auf E-Zigaretten spezialisiert · Erstveröffentlichung: 19.08.2025 · Zuletzt aktualisiert: 12.01.2026
Kurz & Knapp: Aromen in E-Liquids
- Lebensmittelaromen – dieselben Stoffe wie in Joghurt, Süßwaren und Getränken
- Kein Krebsnachweis – pauschale Behauptungen wissenschaftlich nicht belegt
- TPD2-reguliert – strenge Kennzeichnungspflicht seit 2016
- Deutlich weniger schädlich – britische Gesundheitsbehörde OHID bestätigt Schadenspotenzial-Reduktion
- Diacetyl – in EU-Liquids praktisch nicht mehr enthalten
- Keine Verbrennung – Dampf statt Rauch, kein Teer, kein Kohlenmonoxid
- Dosis entscheidend – einzelne Aromastoffe können bei Überkonsum reizen
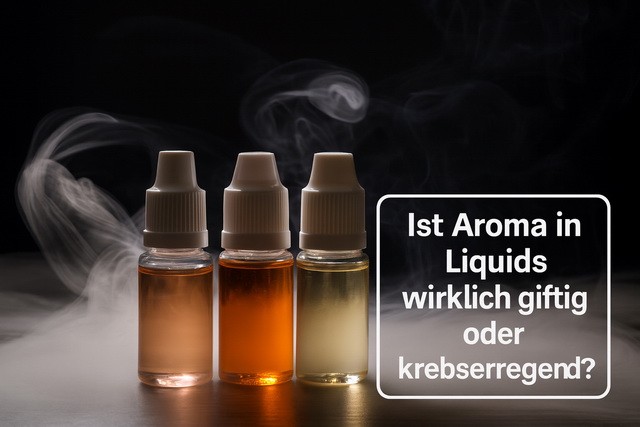
Aromen in Liquids – Fakten statt Panikmache
Seit der Einführung der E-Zigarette gehören sie untrennbar dazu – E-Liquids in einer nahezu unbegrenzten Bandbreite an Geschmacksvarianten. Ob fruchtige Sorten wie Erdbeere oder Heidelbeere, süße Klassiker wie Schokolade, traditionelle Tabakmischungen oder ausgefallene Richtungen wie Waldmeister – die Vielfalt hat sich seit den frühen Jahren des Dampfens stetig weiterentwickelt. Bei der Herstellung kommen überwiegend Aromastoffe zum Einsatz, die auch in der Lebensmittelproduktion bereits seit Jahrzehnten genutzt werden. Im Joghurt, im Kaugummi oder im Softdrink sorgen diese Stoffe kaum für Diskussionen – sobald jedoch identische Verbindungen in E-Liquids Verwendung finden, sehen Kritiker plötzlich ein erhöhtes Krebsrisiko. Warum dieselben Stoffe im Essen unbedenklich, im Liquid aber gefährlich sein sollen, bleibt offen.
Die E-Zigarette stand von Anfang an im Fokus von Interessengruppen, die ihr ein ähnlich negatives Image wie der klassischen Tabakzigarette verpassen wollten. Besonders die Aromen und deren Inhaltsstoffe dienen Kritikern regelmäßig als vermeintlicher Beleg für Gefahren, obwohl gravierende Unterschiede zwischen den chemischen Bestandteilen einer Tabakzigarette und denen eines aromatisierten E-Liquids bestehen – beim Dampfen findet keine Verbrennung statt, es entsteht Aerosol statt Rauch. Dass die Tabakindustrie und ihr nahestehende Stimmen nach Angriffsflächen suchen, überrascht wenig: Liquids mit Geschmacksrichtungen wie Schoko-Vanille oder Maracuja-Orange gelten für viele Menschen als attraktive Alternative und werden häufig sogar als Unterstützung beim Rauchstopp empfohlen. Irgendwo, so das Kalkül, müsse sich doch ein schädigender Zusatzstoff finden lassen.
Nachdem sich die These einer „Popcorn-Lunge" durch Diacetyl wissenschaftlich entkräften ließ – zahlreiche Studien und Analysen zu Diacetyl, Acetylpropionyl und Bronchiolitis obliterans belegten die Unhaltbarkeit dieses Vorwurfs – richtet sich die Aufmerksamkeit der Kritiker inzwischen auf die angeblich krebserregenden Eigenschaften von Liquids. Dabei fehlt es nach wie vor an belastbaren Nachweisen, die einen kausalen Zusammenhang zwischen den verwendeten Aromastoffen und Krebserkrankungen belegen würden. Die europäische Tabakproduktrichtlinie TPD2 reguliert E-Liquids seit Mai 2016 streng – mit verpflichtenden Kennzeichnungen, Inhaltsstoffangaben und Qualitätsstandards, die in vielen anderen Ländern so nicht existieren.
Aussagen zum Krebsrisiko in den Medien
In großen Nachrichtenmedien fanden sich wiederholt Schlagzeilen wie „Risiken von Aromastoffen". Grundlage solcher Berichterstattung war häufig eine Veröffentlichung in der Fachzeitschrift Tobacco Control, in der Wissenschaftler forderten, verbindliche Grenzwerte sowie verpflichtende Deklarationen für aromatische Zusätze in E-Liquids einzuführen. Viele Medien übernahmen dabei die Einschätzung, Aromen seien maßgeblich für die vermeintlichen Gefahren der E-Zigarette verantwortlich – obwohl diese Annahmen durch nachfolgende Forschungsergebnisse nicht bestätigt werden konnten.
Aktuelle Erkenntnisse aus Großbritannien zeichnen ein völlig anderes Bild: Das Office for Health Improvement and Disparities (OHID, vormals Public Health England) bestätigt nach wie vor, dass E-Zigaretten mindestens 95 % weniger schädlich sind als Tabakzigaretten – eine Einschätzung, die seit 2015 besteht und in mehreren unabhängigen Reviews bestätigt wurde. Konsumenten werden dort nicht etwa vor den Gefahren der E-Zigarette gewarnt, sondern über deren Potenzial beim Rauchstopp informiert. Selbst die Deutsche Ärztezeitung hat kritisiert, dass die positiven Effekte der E-Zigarette in der öffentlichen Debatte kaum Beachtung finden, während Schlagzeilen über angebliche Gefahren regelmäßig für Aufmerksamkeit sorgen.
Da zudem der sogenannte „Gateway-Effekt" – die Behauptung, E-Zigaretten würden Nichtraucher zum Tabakkonsum verleiten – wissenschaftlich nicht haltbar ist, verlieren Kritiker zunehmend ihre Argumentationsbasis. An vorderster Front im Kampf gegen Aromen positionieren sich nach wie vor die Pharmaindustrie, die an Nikotinersatzprodukten verdient, sowie bestimmte Interessenverbände, die seit Jahren eine kritische Haltung zur E-Zigarette pflegen. Da ihnen belastbare Argumente fehlen, greifen sie auf das Schreckgespenst „Krebs" zurück – ein rhetorisches Mittel, das emotionale Reaktionen auslöst, aber keiner wissenschaftlichen Prüfung standhält.
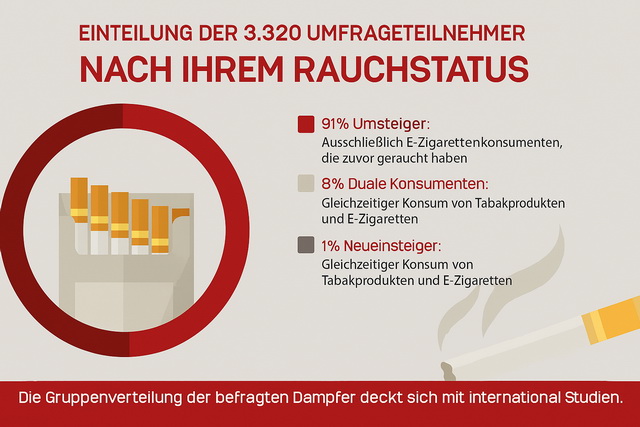
Benzaldehyd und die empfohlene Höchstmenge
In einigen Medienberichten wurde vorgeschlagen, den Gehalt von Benzaldehyd in E-Liquids auf maximal 60 Milligramm zu begrenzen. Legt man diese Berechnungsgrundlage zugrunde, würde bereits der tägliche Konsum von 5 Millilitern Liquid den sogenannten Unbedenklichkeitswert um das Doppelte überschreiten. Dabei enthält Benzaldehyd natürlicherweise rund 95 % aller Bittermandelöle – ohne dass dort je eine solche Höchstgrenze diskutiert oder gefordert worden wäre. Der vorgeschlagene Grenzwert wirkt daher willkürlich und wissenschaftlich kaum belegt, zumal die Stichprobe der ursprünglichen Studie mit nur 30 Liquids bei mehreren Tausend verfügbaren Produkten nicht repräsentativ sein kann.
„Benzaldehyd ist gesundheitsschädlich, wobei eine echte Gesundheitsgefährdung für gewöhnlich nur bei vergleichsweise großen aufgenommenen Mengen zu erwarten ist." — Wikipedia
Diese Argumentationsweise erinnert an frühere, längst widerlegte Behauptungen: etwa dass Propylenglykol, pflanzliches Glycerin oder Wasser beim Dampfen ein Risiko darstellen würden, dass E-Zigaretten-Akkus unkontrolliert explodieren könnten oder dass Spuren von Diacetyl in Liquids zwangsläufig zur Bronchiolitis obliterans führen müssten. Die Diacetyl-Belastung einer herkömmlichen Tabakzigarette liegt mit etwa 301 bis 433 Mikrogramm rund 750-mal höher als in den wenigen Liquids, in denen dieser Stoff überhaupt nachgewiesen wurde – der überwiegende Teil der EU-konformen Liquids ist ohnehin völlig frei davon, da Diacetyl unter TPD2 praktisch aus europäischen Produkten verschwunden ist.
Weder die in Medien genannte Obergrenze für Benzaldehyd noch die dort aufgeführten prozentualen Anteile einzelner Aromakomponenten in Liquids können als allgemeingültig betrachtet werden. Ebenso fehlt es an belastbaren Nachweisen, die diese Werte als gesundheitsgefährdend einstufen würden. Für Sie als Konsument bedeutet das: Wer beim Dampfen Kratzen im Hals verspürt, zum Husten neigt oder ein unangenehmes Gefühl bemerkt, sollte auf die Signale seines Körpers achten und gegebenenfalls das Liquid wechseln oder die Leistung anpassen – mehr dazu im Ratgeber Funktionsweise von E-Zigaretten.
Was für Inhaltsstoffe enthalten Liquids und Aromen?
Viele Medienberichte tragen eher zur Verwirrung bei, als dass sie für Klarheit sorgen, indem sie Begriffe und Zusammenhänge vermischen und nicht sauber zwischen fertigen Liquids und reinen Aromen unterscheiden. Ein E-Liquid besteht aus PG (Propylenglykol), VG (pflanzliches Glycerin), Aromastoffen und – bei nikotinhaltigen Produkten – Nikotin. Die Trägerstoffe PG und VG sind als Lebensmittelzusatzstoffe zugelassen und gelten bei bestimmungsgemäßer Verwendung als unbedenklich.
Gerade der Vergleich mit herkömmlichen Tabakzigaretten macht deutlich: Viele der Substanzen, die in kritischen Medienberichten als problematisch dargestellt werden, finden sich gar nicht in Liquids, sondern sind charakteristische Bestandteile des Tabakrauchs. Eine sorgfältig zusammengestellte Übersicht des Portals ezigarette-magazin.de zeigt diese Unterschiede im Detail und macht klar, wie irreführend eine undifferenzierte Darstellung sein kann.
Typische Aromastoffe in E-Liquids
Die folgenden Stoffe gehören zu den gängigsten Aromabestandteilen in E-Liquids – sie finden sich auch in zahlreichen Lebensmitteln und Kosmetikprodukten:
- Benzaldehyd – Mandelaroma, natürlich in Bittermandeln
- Vanillin – Hauptbestandteil des Vanillearomas
- Tetramethylpyrazin – charakteristisch für Schokolade-Aromen
- Apfelsäure – sorgt für saure Fruchtnoten
- Ethylmaltol – verstärkt süße Geschmacksnoten
Die TPD2-Richtlinie schreibt seit 2016 vor, dass alle Inhaltsstoffe auf der Verpackung deklariert werden müssen. Zusätzlich müssen Hersteller ihre Produkte beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit registrieren und die vollständige Zusammensetzung offenlegen. Mit der geplanten TPD3-Regulierung, die voraussichtlich ab 2027/2028 greifen wird, könnten weitere Einschränkungen für bestimmte Aromastoffe hinzukommen – die genauen Bestimmungen werden derzeit auf EU-Ebene verhandelt. Wer volle Kontrolle über die Zusammensetzung seiner Liquids haben möchte, kann diese auch selbst herstellen.
Vergleich: Tabakzigarette vs. E-Liquid
Der Unterschied zwischen Tabakrauch und E-Zigaretten-Aerosol könnte kaum größer sein: Während beim Verbrennen von Tabak über 7.000 chemische Verbindungen entstehen, von denen mindestens 70 als krebserregend eingestuft sind, besteht E-Zigaretten-Aerosol aus deutlich weniger Substanzen – und die meisten der gefährlichen Stoffe fehlen komplett.
| Inhaltsstoff | Tabakzigarette | E-Liquid |
|---|---|---|
| Nikotin | Ja | Optional (0–20 mg/ml nach TPD2) |
| Teer | Ja (ca. 10 mg pro Zigarette) | Nein |
| Schwermetalle (Quecksilber etc.) | Ja | Nein |
| Nitrosamine | Ja (krebserregend) | Geringfügig (nur in wenigen Liquids) |
| Nickel | Ja | Nein – aber durch Heizdraht möglich |
| Hydrazin | Ja (krebserregend) | Nein |
| Vinylchlorid | Ja (krebserregend) | Nein |
| Benzol | Ja (krebserregend) | Nein |
| Benzo[a]pyren | Ja (stark krebserregend) | Nein |
| Polonium-210 (radioaktiv) | Ja | Nein |
| 3-Methylcholanthren | Ja (krebserregend) | Nein |
| Furfural | Ja | Nein |
| Hydrochinon | Ja | Nein |
| Phenole | Ja | Nein |
| Kresol | Ja | Nein |
| Arsenverbindungen | Ja (krebserregend) | Nein |
| Plutonium* | Ja (radioaktiv) | Nein |
| Thorium | Ja (radioaktiv) | Nein |
| Dibenz[a,h]anthrazen | Ja (krebserregend) | Nein |
| Benzo[b]fluoranthen | Ja (krebserregend) | Nein |
| Dibenzo[a,l]pyren | Ja (krebserregend) | Nein |
| Benz[a]anthrazen | Ja (krebserregend) | Nein |
| Chrysen | Ja (krebserregend) | Nein |
| Dioxine | Ja (hochgiftig) | Nein |
| Indeno[1,2,3-cd]pyren | Ja (krebserregend) | Nein |
| Benzo[c]phenanthren | Ja (krebserregend) | Nein |
| Methylbenzo[a]pyren | Ja (krebserregend) | Nein |
| 5-Methylchrysen | Ja (krebserregend) | Nein |
| 7H-Dibenzo[c,g]carbazol | Ja (krebserregend) | Nein |
| Dimethylnitrosamin | Ja (krebserregend) | Nein |
| N-Nitrosodimethylamin | Ja (krebserregend) | Nein |
| 4-Aminobiphenyl | Ja (krebserregend) | Nein |
| Beta-Naphthylamin | Ja (krebserregend) | Nein |
| Formaldehyd | Ja (ca. 100 µg – 16× mehr) | Minimal (ca. 6 µg bei hohen Temp.) |
| Anilin | Ja | Nein |
| Blei | Ja | Nein |
| Cadmium | Ja (krebserregend) | Nein |
| Acrolein | Ja (reizend) | Nein |
| Kohlenmonoxid | Ja | Nein |
| Toluol | Ja | Nein |
| Acetaldehyd | Ja (ca. 1.300 µg – 86× mehr) | Minimal (ca. 15 µg) |
| Blausäure | Ja | Nein |
| Cyanid | Ja | Nein |
| Zink | Ja | Nein |
| Pyridin | Ja | Nein |
| Ammoniak | Ja | Nein |
| Stickoxide | Ja | Nein |
| Chinolin | Ja | Nein |
| 2-Butanon | Ja | Nein |
| Petroleum-Derivate | Ja | Nein |
| N-Ethyl-N-methylnitrosamin | Ja (krebserregend) | Nein |
| N-Diethylnitrosamin | Ja (krebserregend) | Nein |
| Diacetyl | Ja (301–433 µg – 750× mehr) | In EU-Liquids praktisch ausgeschlossen |
| PG (Propylenglykol)** | Ja (als Feuchthaltemittel) | Ja (Hauptbestandteil) |
| VG (Glycerin, E 422)** | Ja (als Feuchthaltemittel) | Ja (Hauptbestandteil) |
*Plutonium und andere radioaktive Stoffe wurden in Tabak nachgewiesen. Quelle: rauchstoppzentrum.ch
**PG und VG dienen in Tabakzigaretten als Feuchthaltemittel, in E-Zigaretten als Dampf-Basis. Quelle: Wikipedia
Natürliche, naturidentische und künstliche Aromen
Wer die Diskussion über Aromen ernsthaft und differenziert führen möchte, muss tiefer einsteigen als bis zur pauschalen Aussage „Es handelt sich um Aroma." Denn auch Aromen bestehen aus einer Vielzahl einzelner Komponenten, die sich klar voneinander abgrenzen lassen. Es gibt drei Kategorien mit jeweils unterschiedlichen Eigenschaften:
Natürliche Aromastoffe
Natürliche Aromastoffe stammen direkt aus der Natur und werden ohne Einsatz chemischer Verfahren aus pflanzlichen oder tierischen Rohstoffen gewonnen. Ein Beispiel: Vanillearoma aus echten Vanilleschoten oder Erdbeeraroma aus echten Erdbeeren. Das klingt zunächst unbedenklich, doch Vorsicht: „Natürlich" ist nicht gleichbedeutend mit „harmlos" – auch giftige Pflanzen oder Pilze sind Teil der Natur. Zudem enthalten natürliche Aromen meist eine Vielzahl verschiedener Verbindungen, was sie nach der Logik mancher Kritiker sogar zu den „unübersichtlichsten" machen würde. In der Praxis werden sie in E-Liquid-Aromen jedoch nur selten in Reinform eingesetzt, da die Gewinnung aufwendig und teuer ist.
Naturidentische Aromastoffe
Naturidentische Aromastoffe sind das Ergebnis chemischer Synthese, bei der die in der Natur vorkommenden Moleküle präzise nachgebildet werden. Sie gleichen also ihren natürlichen Vorbildern auf molekularer Ebene, sind jedoch oft weniger komplex, da nur die gewünschten Moleküle erzeugt werden. Der Begriff „naturidentisch" wird in der EU-Aromenverordnung (EG) Nr. 1334/2008 seit 2011 offiziell nicht mehr verwendet – heute spricht man von „Aromastoffen", die chemisch synthetisiert wurden. Diese Stoffe stellen die häufigste Kategorie in E-Liquids dar, da sie kostengünstig herzustellen sind und gleichbleibende Qualität bieten.
Künstliche Aromastoffe
Künstliche Aromastoffe entstehen vollständig im Labor und haben kein direktes Vorbild in der Natur. Sie sind in ihrer Struktur klar definiert, besonders rein und enthalten im Vergleich die wenigsten Begleitstoffe – wenngleich ihnen dadurch der „natürliche" Anstrich fehlt. Ein bekanntes Beispiel ist Ethylvanillin, das intensiver schmeckt als natürliches Vanillin und in vielen Dessert-Liquids zum Einsatz kommt.
Häufig wird argumentiert, dass ein „gutes" Aroma durch eine geringe Anzahl an Inhaltsstoffen gekennzeichnet sei – folgt man dieser Logik, müssten streng genommen die vollständig synthetischen Aromen als die verträglichsten gelten, da sie am reinsten zusammengesetzt sind. Die Realität ist komplexer: Pauschale Aussagen über Gefährlichkeit oder Unbedenklichkeit lassen sich weder aus der Herkunft noch aus der Anzahl der Bestandteile ableiten. Entscheidend ist vielmehr, welche konkreten Stoffe in welcher Konzentration enthalten sind – und genau das regelt die TPD2 mit verpflichtenden Deklarationen.
Fazit: Die Dosis macht das Gift
Die Diskussion um angeblich giftige oder krebserregende Aromen in E-Liquids wird seit Jahren von Interessengruppen befeuert, denen die E-Zigarette als erfolgreiche Alternative zur Tabakzigarette ein Dorn im Auge ist. Die in E-Liquids verwendeten Aromastoffe kommen auch in Lebensmitteln zum Einsatz und gelten dort seit Jahrzehnten als sicher. Ein pauschaler Krebsnachweis für diese Stoffe existiert nicht – weder in Lebensmitteln noch in E-Liquids.
Entscheidend bleibt stets die Menge – oder anders gesagt: „Die Dosis macht das Gift." Einzelne Aromastoffe können bei übermäßigem Konsum durchaus Reizungen der Atemwege oder Schleimhäute verursachen, und wer solche Symptome bemerkt, sollte auf die Signale seines Körpers achten: Das Liquid wechseln, die Verdampfer-Einstellungen anpassen oder ein Pod-System mit geringerer Leistung nutzen. Daraus jedoch abzuleiten, dass herkömmliche Tabakprodukte eine sicherere Wahl wären, wäre ein fataler Irrtum: Die Inhaltsstoffe klassischer Zigaretten sind nachweislich deutlich gefährlicher, und bei der Verbrennung entstehen Schadstoffe, die für hunderttausende Todesfälle jährlich verantwortlich sind – Stoffe, die beim Dampfen nicht entstehen.
Wichtiger Hinweis: Für Menschen, die bislang weder rauchen noch dampfen, bleibt die klare Empfehlung bestehen: am besten auch weiterhin ganz darauf verzichten. E-Zigaretten sind eine Alternative für erwachsene Raucher, kein Lifestyle-Produkt für Nichtraucher.
Anfang 2026 bleibt das Bild unverändert: E-Zigaretten sind keine risikofreien Produkte, aber sie sind erheblich weniger schädlich als Tabakzigaretten. Die Aromen, die den Geschmack von Longfills und fertigen Liquids ausmachen, sind dabei nicht der gefährliche Faktor, als der sie in manchen Medienberichten dargestellt werden – sie sind vielmehr ein Grund, warum viele ehemalige Raucher den Umstieg geschafft haben und dauerhaft dabei geblieben sind.
Häufige Fragen
Ist Aroma in Liquids wirklich giftig oder krebserregend?
Lebensmittelaromen in Liquids werden verdampft, nicht verbrannt. Pauschale Krebsbehauptungen sind wissenschaftlich nicht belegt. Die verwendeten Aromastoffe sind dieselben, die auch in Joghurt, Süßwaren und Getränken zum Einsatz kommen.
Wie sind Medienaussagen zum Krebsrisiko zu bewerten?
Viele Schlagzeilen stützen sich auf schwache Daten und kleine Stichproben. Die TPD2-Richtlinie regelt seit 2016 die Kennzeichnung und Qualitätsstandards für E-Liquids in der EU. Aktuelle Evidenz zeigt eher Nutzen beim Rauchstopp als eine generelle Gefährdung.
Was gilt für Benzaldehyd und empfohlene Höchstmengen?
Der vorgeschlagene 60-mg-Grenzwert wirkt willkürlich und basiert auf einer kleinen Stichprobe von nur 30 Liquids. Benzaldehyd kommt natürlicherweise in rund 95 % aller Bittermandelöle vor, ohne dass dort je eine solche Höchstgrenze diskutiert wurde.
Welche Inhaltsstoffe enthalten Liquids und Aromen?
E-Liquids bestehen primär aus PG und VG als Trägerstoffen, Aromastoffen und optional Nikotin. Typische Aromastoffe sind Vanillin, Benzaldehyd, Apfelsäure und Ethylmaltol. Viele in Medien genannte Schadstoffe stammen aus Tabakrauch, nicht aus E-Liquids.
Ist Diacetyl in EU-Liquids noch ein Problem?
Nein, praktisch nicht mehr. Unter der TPD2-Regulierung ist Diacetyl aus europäischen E-Liquids weitgehend verschwunden. Zum Vergleich: Eine Tabakzigarette enthält rund 750-mal mehr Diacetyl.
Macht es einen Unterschied, ob ich MTL oder Sub-Ohm dampfe?
Ja, durchaus. MTL-Geräte arbeiten mit geringerer Leistung und verbrauchen weniger Liquid, während Sub-Ohm-Setups mehr Dampf und damit mehr Aerosol erzeugen. Wer empfindlich auf bestimmte Aromen reagiert, könnte mit einem Pod-System besser zurechtkommen.
Was ändert sich durch TPD3?
Die TPD3-Regulierung wird voraussichtlich ab 2027/2028 neue Vorgaben für E-Zigaretten und Liquids in der EU bringen. Diskutiert werden unter anderem Einschränkungen bei bestimmten Aromastoffen und zusätzliche Kennzeichnungspflichten.
Über den Autor
Gründer & Geschäftsführer, MaxVapor
MaxVapor wurde 2008 gegründet; seit 2012 mit Spezialisierung auf E-Zigaretten und Liquids. Über 14 Jahre Expertise in Produktberatung, TPD2-Compliance und technischer Beratung. Verantwortlich für Produktprüfung und Kundenkommunikation bei MaxVapor.
Qualifikation: • Unternehmensgründung 2008
• E-Zigaretten-Fachhandel seit 2012
• Fachkenntnisse TPD2-Richtlinien
• Produktschulung & Beratung
• Eingetragener Kaufmann
Erstveröffentlichung: · Zuletzt aktualisiert: . Inhalte werden redaktionell geprüft. Keine Gesundheitsversprechen; alle Angaben ohne Gewähr.
Facebook (Oliver Prust) • LinkedIn • Facebook (MaxVapor) • Instagram